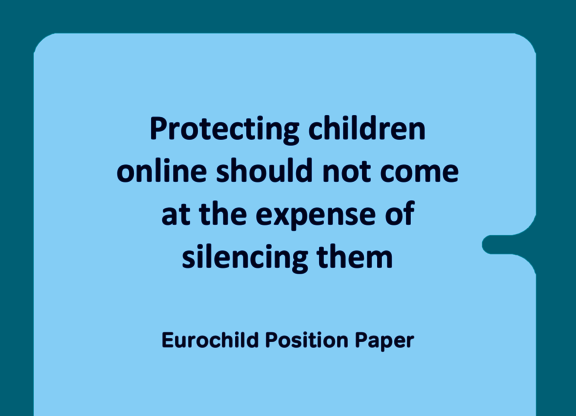Weltweit werden die Stimmen lauter, die einen stärkeren Schutz junger Menschen in den sozialen Medien fordern. Im Zentrum der Debatte steht dabei die Frage, ob Altersgrenzen und technische Zugangsbeschränkungen einen wirksamen Schutz bieten können. Herangezogen wird dabei oft Australien, das ab Dezember 2025 als erstes Land weltweit ein Nutzungsverbot für soziale Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren umsetzen wird. In mehreren EU-Mitgliedstaaten wird zunehmend darüber diskutiert, diesem Beispiel zu folgen. Auch in Deutschland wird sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie junge Menschen online noch besser geschützt werden können. Vor diesem Hintergrund wurde kürzlich eine Expertenkommission einberufen. Diese soll bis Ende des Sommers 2026 eine umfassende Strategie zum „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ für Bund, Länder und Zivilgesellschaft erarbeiten.
In diesem Zusammenhang spricht sich die zivilgesellschaftliche Organisation Eurochild, ein europäisches Netzwerk von 225 Kinderrechtsorganisationen aus 41 Ländern, gegen pauschale Altersgrenzen von 15 oder 16 Jahren für soziale Medien aus. In einem im September veröffentlichten veröffentlichten Positionspapier mit dem Titel „Protecting children online should not come at the expense of silencing them“ (Deutsch: Der Schutz von Kindern im Internet sollte nicht auf Kosten ihrer Meinungsfreiheit gehen), äußert das Netzwerk die Befürchtung, dass ein sogenanntes „Digital Age of Majority“ junge Menschen vom digitalen Raum ausschließen könnte. In dem Positionspapier wird betont, dass die drei Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention – Schutz, Befähigung und Teilhabe – gleichermaßen berücksichtigt werden müssen, wie es auch in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 (2025) verdeutlicht wird. Statt für Ausschlüsse plädiert Eurochild für einen kinderrechtsbasierten, evidenzgestützten und mehrstufigen Ansatz, der Kindern sichere und inklusive digitale Räume ermöglicht. Eurochild argumentiert, dass digitale Plattformen eine zentrale Infrastruktur für Kinder darstellen, etwa für das Lernen, soziale Interaktionen, kreative Entfaltung sowie politische und zivilgesellschaftliche Teilhabe. Eine pauschale Einschränkung des Zugangs würde Kindern grundlegende Rechte vorenthalten, die in der UN-Kinderrechtskonvention verankert sind, darunter das Recht auf Information (Art. 17), das Recht auf Meinungsfreiheit (Art. 13) und das Recht auf Partizipation (Art. 12). Dies trifft junge Menschen insbesondere in Ländern, in denen diese Rechte ohnehin schon stark eingeschränkt sind. Darüber hinaus warnt Eurochild , dass solche Zugangsbeschränkungen die Entwicklung digitaler Kompetenzen verhindern und bestehende Bildungsungleichheiten weiter verstärken könnten.
Nicht zuletzt betont das Netzwerk, dass der Zugang zu digitalen Medien auch eine Schutzfunktion erfüllt. Kinder und Jugendliche erhalten dort beispielsweise Informationen über Hilfsangebote, Zugang zu Notrufstellen oder Möglichkeiten zur Meldung von Gewaltvorfällen. Gerade für besonders schutzbedürftige Gruppen ist ein sicherer und barrierefreier Zugang daher essenziell. Außerdem wird vor den Folgen eines Verbots gewarnt: Wenn Altersbeschränkungen gelten, besteht die Befürchtung, dass Kinder und Jugendliche zu riskanten und weniger regulierten Plattformen wechseln.
Eurochild verdeutlicht somit, dass Kinderrechte nicht nur offline, sondern auch im digitalen Raum umfassend gewährleistet werden müssen und regt folgende politische Empfehlungen an:
- kinderrechtsbasierte Lösungen anzubieten , anstatt Kinder im Internet unverhältnismäßig einzuschränken;
- Regulierung im Sinne von „Safety by Design unterstützen;
- Initiativen zur Förderung der digitalen Kompetenz von Kindern, Erziehungsberechtigten und Lehrpersonal fördern;
- die Transparenz und Verantwortlichkeit von Online-Plattformen stärken;
- sinnvolle Beteiligung von Kindern an der Gestaltung der Digitalpolitik und von Plattformen gewährleisten.
Das Eurochild-Positionspapier kann im Hintergrundbereich oder im direkten Download unter der Website heruntergeladen werden.